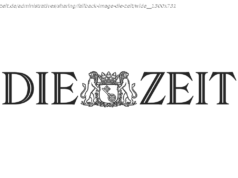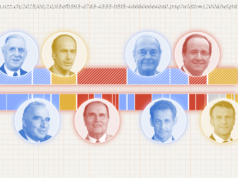Spätestens Anfang April muss aus Sicht von CSU-Chef Horst Seehofer die Bildung der neuen Bundesregierung zwischen Union und SPD beendet sein.
Begründet wird der Wunsch nach einer Erhöhung in der Beschlussvorlage damit, dass für „ein sicheres Deutschland, das seiner europäischen und internationalen Verantwortung gerecht wird“, „eine schlagkräftige, moderne Bundeswehr“ nötig sei. Die „bestmögliche Ausrüstung, Ausbildung und Betreuung der Soldatinnen und Soldaten“ wie auch die Modernisierung der Bundeswehr kosteten Geld. Investitionen seien unter anderem „in den Bereichen Digitalisierung, Verlege- und Transportfähigkeit, unbemannte Aufklärung und bewaffnungsfähige Drohnen sowie mobile taktische Kommunikation notwendig“. Deshalb müsse der Etat erhöht werden.
Die Forderungen der CSU nach höhren Verteidigungsausgaben sowie schärferen EU-Regeln bei Flüchtlingen und Grenzkontrollen gefährden laut Parteichef Horst Seehofer jedoch nicht die anstehenden Sondierungen mit der SPD. „Ich empfehle uns allen Disziplin und Zurückhaltung“, sagte er am Freitag in München. Was die CSU-Landesgruppe mache, sei in Ordnung. „Sie hat immerhin eine Klausurtagung, und das man sich in Klausurtagungen noch einmal inhaltlich positioniert, ist völlig in Ordnung.“
Unabhängig von den Forderungen halte die CSU an ihrem Ziel fest, endlich eine neue stabile Regierung bilden zu können. „Jetzt kämpfen wir für eine Regierungsbildung mit der SPD, und die Grundlage unserer Verhandlungen ist, was wir im Wahlkampf der Bevölkerung gesagt und versprochen haben“, sagte Seehofer. Kompromisse könnten nur am Verhandlungstisch und nicht in Interviews geschmiedet werden. „Und dazu gehört auch, dass wir unsere Soldatinnen und Soldaten finanziell besser ausstatten, insbesondere mit der Ausrüstung.“
Der CSU-Politiker reagierte damit auf den nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Armin Laschet, der mehr Kompromissbereitschaft bei diesem Thema gefordert hatte. Er hatte in der ARD erklärt, er halte den Weg, „einen „behutsamen Ausgleich“ zu finden zwischen der Begrenzung von Zuwanderung und den Möglichkeiten der Integration auf der einen Seite und den Einzelfällen und den humanitären Fällen auf der anderen Seite, für eine gute Formel, die eine Lösung bringen könnte.“ Neben humanitären Härtefällen müsse der Familiennachzug auch für Flüchtlinge möglich sein, die Wohnung und Arbeit hätten.
Laschet verwies seinerzeit auf ein rechtskräftig gewordenes Urteil des Berliner Verwaltungsgerichts. Das Auswärtige Amt wurde demnach aufgefordert, einem inzwischen 16-jährigen syrischen Flüchtling mit einer schweren Traumatisierung den Nachzug seiner Eltern und Geschwister zu ermöglichen, obwohl ihm nur der subsidiäre, also eingeschränkte Schutz zuerkannt worden war.
Der CSU-Innenpolitiker Stephan Mayer sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland: „Für eine Ausweitung der Härtefallregelung bin ich offen, insbesondere um bei besonders tragischen Schicksalen, beispielsweise bei einer schwerwiegenden oder tödlichen Erkrankung, die Familienzusammenführung leichter und schneller zu ermöglichen.“
Dagegen betonte die Flüchtlingsorganisation Pro Asyl: „Eine Härtefallregelung ist absolut nicht ausreichend. Wer will nach welchen Kriterien auswählen, wer aus dem Kriegs- und Krisengebiet ausreisen darf und wer nicht. Das ist nebulös.“
Die Schwierigkeiten bei der Regierungsbildung lassen den Rückhalt für Kanzlerin Angela Merkel in der Bevölkerung bröckeln. Nach einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov im Auftrag der Deutschen Presse-Agentur wünscht sich inzwischen fast jeder Zweite (47 Prozent), dass die CDU-Vorsitzende bei einer Wiederwahl zur Regierungschefin ihren Posten vor Ende der Wahlperiode 2021 räumt. Nur 36 Prozent wollen sie weitere vier Jahre im Amt sehen.
Kurz nach der Bundestagswahl war die Unterstützung für Merkel noch deutlich größer. In einer YouGov-Umfrage Anfang Oktober hatten sich nur 36 Prozent für einen vorzeitigen Abgang Merkels ausgesprochen. 44 Prozent waren dafür, dass sie ihren Posten bis 2021 behält.
Am 7. Januar beginnen die Sondierungsgespräche zwischen Union und SPD über eine Regierungsbildung. Mögliche Ergebnisse sind eine große Koalition oder eine Minderheitsregierung unter Merkel. Bei einem Scheitern der Gespräche könnte es aber auch zu einer Neuwahl kommen oder zu einer Wiederaufnahme der Jamaika-Gespräche.
FDP-Vize Wolfgang Kubicki hat Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) für das Scheitern der Jamaika-Sondierungen verantwortlich gemacht. Merkel sei es nie darum gegangen, Jamaika hinzubekommen, sagte Kubicki den Zeitungen der Funke Mediengruppe. „Sie hat daran gebastelt, die Fortsetzung der großen Koalition zu erreichen. Das ist ihr gelungen.“ Die SPD sei heute genau da, wo Merkel sie haben wolle, sagte Kubicki weiter. Die Chance für eine Neuauflage von Schwarz-Rot liege „bei 80 Prozent“.
Die Union rief der FDP-Politiker zur personellen Erneuerung auf. Es sei nicht seine Aufgabe zu sagen, Merkel müsse weg, sagte er. Die Union müsse selbst wissen, wie sie aus „dem Jammertal der knapp 30 Prozent“ herauskommen wolle.
Es gebe aber in der CDU eine ganze Reihe guter Leute, die für die Erneuerung stünden, sagte Kubicki weiter. Er nannte namentlich das CDU-Präsidiumsmitglied Jens Spahn und den schleswig-holsteinischen Ministerpräsidenten Daniel Günther. Mit Merkels „Rezepten der letzten zwölf Jahre“ werde Deutschland in Zukunft nicht bestehen können, bekräftigte er.
Vor den im Januar beginnenden Sondierungsgesprächen von Union und SPD dringt der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) auf Steuererhöhungen. Die Vermögensteuer müsse wieder eingeführt und die pauschale Abgeltungssteuer für Kapitalerträge abgeschafft werden, sagte DGB-Vorstandsmitglied Stefan Körzell. „Wer mehr Verteilungsgerechtigkeit will, muss sich an Steuererhöhungen herantrauen“, sagte Körzell den Zeitungen der Funke Mediengruppe (Mittwochsausgaben). Unternehmer und Vermögende müssten sich mehr als bisher an der Finanzierung der öffentlichen Infrastruktur beteiligen. Zudem müssten Einnahmen aus dem Solidaritätszuschlag für Zukunftsinvestitionen verwendet werden. Eine Abschaffung des Soli wäre eine Steuersenkung für Gutverdiener, sagte Körzell. „Das ist unsinnig und ungerecht.“
Aus Sicht des DGB gehe nur das Steuerkonzept der SPD in die richtige Richtung. CDU und CSU wollten „denen noch mehr geben, die ohnehin schon genug haben“, kritisierte Körzell. Anders als von der SPD geplant dürfe der Spitzensteuersatz aber erst bei 70.000 Euro greifen. Eine Grenze bei 60.000 Euro, wie die Sozialdemokraten sie vorschlagen, „würde schon Facharbeiter treffen“.
Union und SPD gehen am 7. Januar in die Sondierung.
Die Neugestaltung der EU-Beziehungen zu Großbritannien könnte nach Ansicht von Bundesaußenminister Sigmar Gabriel als Vorbild für das Verhältnis zur Türkei und zur Ukraine dienen. Eine Mitgliedschaft der beiden Staaten in der EU könne er sich für die nächsten Jahre nicht vorstellen, sagte der SPD-Politiker den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Deshalb müsse man „über alternative Formen einer engeren Zusammenarbeit nachdenken“. Ein „kluges“ Brexit-Abkommen könnte dabei Modell sein.
Eine der Lehren aus der letzten Legislaturperiode sei, „dass durch die große Mehrheit der großen Koalition die Kontroverse gefehlt hat“, sagte Schneider, der dem Sondierungsteam der SPD angehört. Auch die Union müsse ein Interesse daran haben, dass das Parlament in seiner Rolle als „zentraler Debattenort des Landes“ gestärkt werde. „Ich glaube, dass man in den ersten Monaten des neuen Jahres zu einer Einigung kommen kann.“
In seiner Weihnachtsansprache hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier angesichts der schleppenden Regierungsbildung um Vertrauen in den Staat geworben. „Ich versichere Ihnen: Der Staat handelt nach den Regeln, die unsere Verfassung für eine Situation wie diese ausdrücklich vorsieht, auch wenn solche Regeln in den letzten Jahrzehnten nie gebraucht wurden“, sagte Steinmeier in seiner ersten Weihnachtsansprache als Staatsoberhaupt. „Deshalb: Wir können Vertrauen haben.“
Nach dem Scheitern der Jamaika-Sondierungen von Union, FDP und Grünen hatte sich Steinmeier gegen Neuwahlen ausgesprochen und die Parteien zur Gesprächsbereitschaft aufgefordert. Die SPD erklärte sich daraufhin trotz großer Bedenken zu Verhandlungen mit der Union über eine Regierungsbildung bereit, die Sondierungen beginnen im Januar.
Es müsse „nicht alles Unerwartete uns das Fürchten lehren“, sagte Steinmeier. „Das gilt auch für Regierungsbildungen, die in ungewohnter Weise auf sich warten lassen.“ Deutschland ist inzwischen so lange nach einer Bundestagswahl ohne neue Regierung wie noch nie zuvor.
Das Kooperationsverbot verbietet eine finanzielle Unterstützung des Bundes für Länder und Kommunen im Bildungsbereich. In der vergangenen Legislaturperiode wurde die Regelung bereits an manchen Stellen aufgeweicht. Doch angesichts maroder Schulen sowie fehlender Computer und WLAN-Anschlüsse ist die Regelung weiter in der Kritik.
Nur wenn das Kooperationsverbot falle, „können wir mit Bundesmitteln die Ganztagsschulen flächendeckend in Deutschland ausbauen und in allen Schulen digitale Bildung voranbringen“, sagte der Bildungsexperte Heil.