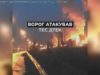Auschwitz und Buchenwald werden missbraucht, um über Tagespolitik zu diskutieren. So banalisiert man die Vergangenheit und setzt den Horror der industriellen Morde in verharmlosende, falsche Kontexte.
Auschwitz und Buchenwald werden missbraucht, um über Tagespolitik zu diskutieren. So banalisiert man die Vergangenheit und setzt den Horror der industriellen Morde in verharmlosende, falsche Kontexte.Gedenksteine in Buchenwald. In dem Konzentrationslager nahe Weimar kamen schätzungsweise 56 000 Menschen ums Leben. Es wurde am 11. April 1945 von amerikanischen Soldaten befreit.
Das Gelände eines ehemaligen Konzentrationslagers zu betreten, ist im Leben eines fühlenden und denkenden Menschen eine einschneidende, oft lebenslang prägende Erfahrung. «O die Schornsteine / Auf den sinnreich erdachten Wohnungen des Todes» (Nelly Sachs) zu sehen, bedeutet, sich dem Begreifen dessen ansatzweise anzunähern, was Menschen durch andere auf diesen Quadratmetern, in diesen Räumen, Kammern, verständig geplanten und funktional erbauten Mordgebäuden, erlitten haben.
NZZ.ch benötigt JavaScript für wichtige Funktionen. Ihr Browser oder Adblocker verhindert dies momentan.
Bitte passen Sie die Einstellungen an.
Die Erinnerung an den Holocaust ist in Deutschland eine grundsätzliche Aufgabe, die glücklicherweise Orte, Zeiträume und Institutionen durchdringt: in den Gedenkstätten natürlich, aber auch in den Medien, den Schulen, in der Erwachsenenbildung, in öffentlichen Gebäuden und vor allem in den Reden an Gedenktagen. Der Umgang mit der Erinnerung ist zugleich ein Gradmesser für den gesellschaftlichen Anstand – so wie wachsender Antisemitismus ein zuverlässiges Anzeichen für eine zunehmend kranke Gesellschaft ist.Bald kann kein Überlebender mehr berichten
Das noch junge Jahr 2025 markiert dabei eine Zäsur. Es fällt in eine Zeit, in der die Berichte derjenigen, die den Holocaust erlebt haben, endgültig abreissen. Intellektuellen wie Jean Améry oder Paul Celan war es einst möglich, ihr eigenes Erleben mit der ihnen eigenen Geistesschärfe zu kombinieren und so die Frage nach der möglichen, richtigen Erinnerung zu beantworten oder zumindest zu diskutieren. Sie konnten auch Vereinnahmungen des Erinnerns entschieden und glaubwürdig entgegentreten. Aber sie sind nicht mehr unter uns.
Gleichzeitig hat sich die Gesellschaft durch die Verschiebung von traditionellen zu sozialen Netzwerken in einen Zustand begeben, in dem sekündlich unglaubliche Dinge – von der Alltagslüge bis zur Holocaustleugnung – veröffentlicht werden, ohne dass die Aussagen auch nur milde Empörung auslösen. Und das Wissen über den Holocaust ist immer weniger präsent. Bei einer repräsentativen Befragung im Herbst 2023 gaben etwa 40 Prozent der 18- bis 29-Jährigen in Deutschland an, nicht zu wissen, dass etwa sechs Millionen Juden unter deutscher Herrschaft ermordet wurden.
Es wäre deshalb notwendiger denn je, an das zu erinnern, was war. Stattdessen aber wird die Erinnerung zunehmend zur Interpretationssache. Zufall? Nicht, wenn man sich anschaut, wer eingeladen wird, Reden zu halten und Gedenktexte zu schreiben.
Ein erster Tiefpunkt des Jahres war es, als der «Spiegel» am Jahrestag der Befreiung von Auschwitz im Januar titelte: «Der Holocaust dient Israel als Lehre der Unmenschlichkeit». An dem Tag also, an dem der Ermordeten gedacht wurde, zog ein deutsches Medium eine Parallele zwischen dem Land, in das sich Überlebende mit letzter Kraft geflüchtet hatten, und dem mörderischen Regime, das Juden systematisch in die Vernichtung getrieben hatte.Die Opfer von damals sollen die Täter von heute sein
Nach der Interpretation, die der «Spiegel» mindestens in der Überschrift transportierte, haben die Opfer aus den Lagern, die dem an ihnen geplanten Mord entrinnen konnten und es oft nur schwer traumatisiert in den sicheren Hafen Israel geschafft haben, aus ihrem Erlebten «die Unmenschlichkeit» gelernt. Die Opfer von damals (oder ihre Nachfahren) sind demnach die Täter von heute. Es ist eine Aussage über den Holocaust, die noch vor wenigen Jahren nur in extremistischen Kreisen existierte.